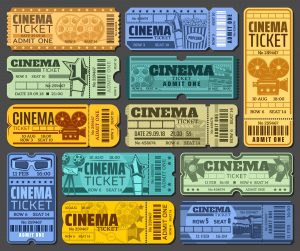Der gefährliche Weg zur Wahrheit
Hybris
Mein Debüt-Roman ist eine lyrische Dystopie, das Genre aus dem Griechischen entlehnt: Dys bedeutet schlecht, Tópos der Ort. Die Bedeutung des Wortes Hybris variiert von Übermut über Vermessenheit bis zu (moralischem) Frevel. Kurz: Eine in unheilvoller Zukunft angesiedelte Story, bei Hybris mit lyrischen Elementen und einer poetischen Sprache.
Die meisten Menschen machen sich Gedanken über ihre Zukunft, viele auch über das Morgen der Menschheit. Ich habe mich gefragt, wie eine Zukunft aussehen könnte, wenn die Geschichte der Menschheit unterbrochen würde. Was wäre noch vorhanden? Was noch wichtig? Würden wir uns besinnen, aus den verbliebenen Bausteinen eine „bessere“ Welt bauen, die weniger auf Gier, Geiz, Geld basiert? Falls uns dies gelänge, wären wir darin glücklichere Menschen? Nehmen wir dies für einen Moment an, stellen uns eine Schar glücklicher Menschen vor, die außer zutiefst menschlichen Bedürfnissen – Nahrung, Beschäftigung, Liebe – kein Verlangen verspürten, ihre friedliche Welt zu verändern. Hört sich gut an? Ist es vordergründig auch. Aber ist es auch realistisch?
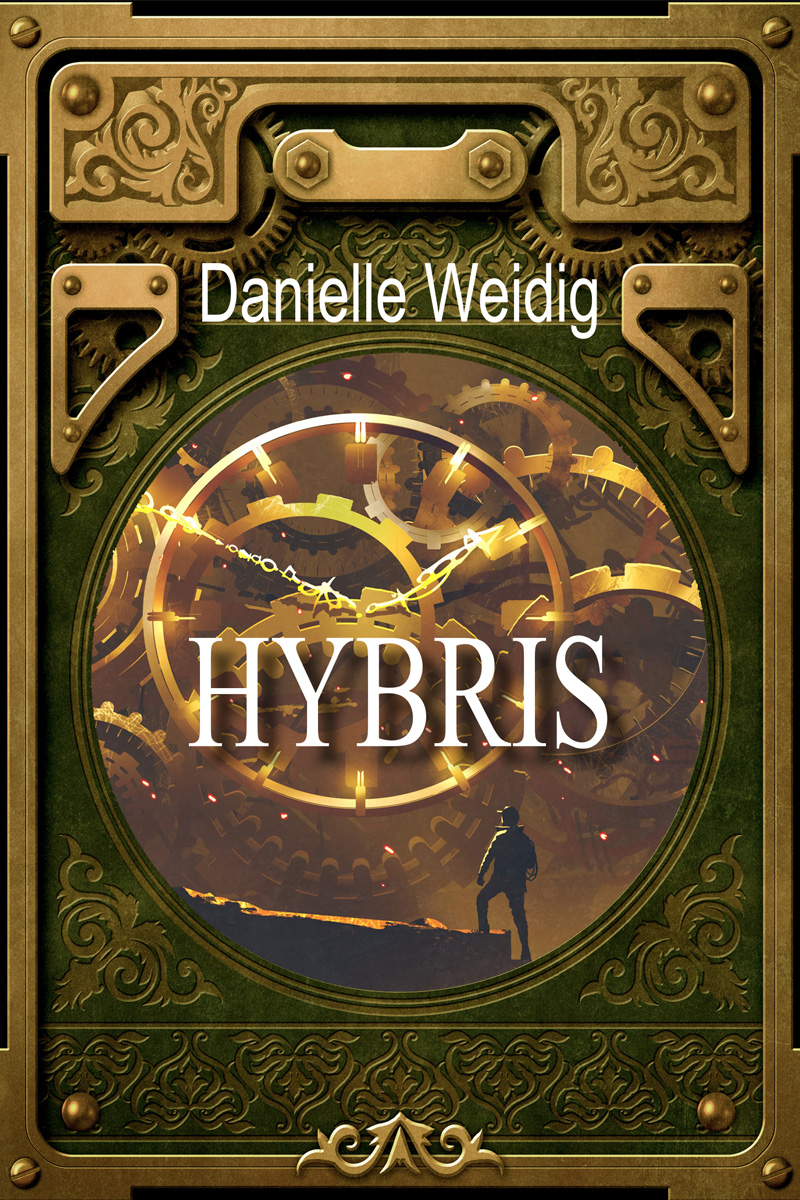
Die Story
In der Zukunft von Hybris ist genau dies gelungen: Ein abgeschottetes, elysisches Fleckchen, genannt Hokolesqua, bewohnt von (zumeist) friedvollen, einander gleichgestellten Menschen, die sich den Unterhalt mit ihrer Hände Arbeit sichern. Wichtigstes Ziel ist, das Tagwerk zu vollbringen und ein gesundes, gottesfürchtiges Leben zu führen, wozu alle Bürger jeden Tag zur Frühstückssuppe ihre von den Oberen verordnete Tinktur kippen.
An dieser Stelle horcht der geübte Leser auf ☺. Zu Recht! Denn die erste Abweichung von der Gleichbehandlung ist, dass für normale Bürger eine Sorte Tinktur, für die Herrschenden heimlich eine andere Essenz gebraut wird.
In diesem Beinahe-Paradies lebt ein junger Mann, der mit den besten Absichten gewappnet und einer ungekannten – und unerwünschten – Vorstellungskraft ausgerüstet, diese Idylle (zer-)stören könnte. Wie werden die Menschen reagieren? Freude über Fortschritt?
Nein! Angst vorm Anderssein, Furcht vor Veränderung.
Hybris Zitate
Verordneter Frieden
Der junge Farmer Gavri’el van Geel führt ein einfaches Leben am Rande Hokolesquas. Er bewirtschaftet Äcker und kümmert sich um seine Tiere: Ochsen, Kühe, Schafe und Hunde, allen voran sein Liebling Gofflin, ein zottiger, rußschwarzer Riese, dessen Vater vielleicht ein Neufundländer war. Ein krasser Farbkonstrat zu den Haarfarben der Bürger Hokolesquas, deren Palette, ob jung, ob alt, von eierschalenweiß, eishell, lilienrein bis hin zu madensilbrig reicht. Hiervon abgesehen, ist Hokolesqua eine farbenfrohe Stadt, malerisch umgeben von einer idyllischen, hügeligen Landschaft voller Grasflächen. Im Sommer besprenkelt mit Butterblumen, Gänseblümchen, Lavendel, Kornrade, Löwenzahn, Zahnwurz, Glockenblumen und Huflattich.
Gavri’els Blicke schweifen aus graugrünen Augen über die flachsgelbe Wolle hell blökender Schafe und das weiß-braun gescheckte Fell grasender Kühe, verweilen dann in einem mit krautigen Wiesen dicht betupften Tal. Der Atem des Nordwinds führt den Duft der Spätsommerwiesen mit sich, er bläst Gavri’els überschulterlanges, schlohweißes Haar ungebändigt in Richtung eines felsenschroffen Gebirges. Hinter dem Gebirgszug, vor neugierigen Blicken verborgen, kreisen rauchgraue Windkrafträder gleich schweigenden Riesen.
Grenzenlose Liebe
Gavri’el hat seine Farm ORIGO, den Ursprung, getauft und lebt dort mit seiner großen Liebe Aglaya. Beide sind seit drei Frühjahren verheiratet, doch noch immer keine Eltern, obwohl sie sich viele Kinder wünschen. Wohlwissend, dass Origo dann zu klein sein würde und sie Land hinzutauschen müssten (in Hokolesqua ist jede Form von Geld unbekannt).
»Gavri’el?«, empfängt ihn die warme Stimme seiner Frau.
»Aglaya«, ruft er und läuft in die von hohen Kerzen gedämpft erhellte Küche.
Nah zieht er Aglaya zu sich, ihr schneehelles Haar fällt bis zur Taille und ihre grazile Gestalt verliert sich fast in seiner Umarmung.
In gespielter Empörung funkeln grünblau gesprenkelte Augen zu ihm auf. »Gavri’el van Geel! Zumindest die Schuhe könntest du ausziehen, sieh, wie viel Dreck du mitbringst. Obendrein bist du völlig durchnässt, gib mich frei.« Doch schmiegen sich ihre Arme eng um seine Hüften und ihr Gesicht kuschelt sich an seine Brust. Lächelnd mahnt sie: »Abendbrot ist fertig, am besten, du wäschst den Tag von dir.«
Vertreibung aus dem Paradies
Hokolesqua ist eine mittelalterliche Stadt, auf ihrem Marktplatz treffen sich die Bürger, um Waren und Dienstleistungen zu tauschen. Dann schrillt ein Potpourri aus dem Geschrei der Marketender gemixt mit viehischem Ochsengebrüll und gereiztem Pferdewiehern über den Platz, und ein Gemisch aus gebratenem Fleisch, Gewürzen und kandierten Leckereien weht durch die Gassen. Hokolesquas Schule lehrt, dass außerhalb der Kupfer verzierten Stadttore keine Zivilisation existiert. Dennoch werden diese Tore nachts fest verriegelt, obwohl laut Chroniken kein Fremder Hokolesqua betreten hat, seit die Stadt vor 500 Jahren, also 2150 nach Christus, gegründet wurde. Es gibt keinen Strom, Telefon oder gar Internet, das Modernste ist die Räderuhr des Kirchturms, die später eine wichtige Rolle übernehmen wird (ebenso wie der alte Feigenbaum vor den Toren der Stadt).
Kein Strom … aber hat die Autorin nicht oben von Windkrafträdern geschrieben? Gut aufgepasst! Nicht alles ist, wie es auf den ersten, zweiten oder dritten Blick scheint und auch Gavri’els Ideenkraft ist schon lange ein Dorn im Schweinsäuglein des Bürgermeisters Abe Taylor. Gavri’els Unheil zieht herauf, als er an einem wunderschönen Markttag den Platzwächter bittet, einen Menschenauflauf zu zaubern, um seine neueste Erfindung, ein Tretspinnrad, zu präsentieren:
Der Sündenfall
Für Momente steht der Platzwächter still, Zeige- und Mittelfinger über der knubbeligen Nasenspitze gekreuzt. Mit einem Mal trippelt er, sich wie im Tanz wiegend, die Glocke über dem Kopf schwingend, über den Platz:
»Ihr Leute hört, hört auf mein Rufen,
ein Ende hat nun euer Suchen.
Nur mit dem Tritt von eurem Schuh
spinnt Ihr alsbald das Garn im Nu.
Wie’s geht, erfahrt ihr hier ganz schnell,
kommt her zum Stand von Gavri’el!«Im Rathaus stemmt sich Hokolesquas Bürgermeister ächzend aus einem überbreiten, schweinsledernen Stuhl, walzt zum Fenster und blickt auf die Menschenschar. Er lauscht, wie Gavri’el sein Spinnrad vorführt. Abe Taylors dürftige Augenbrauen ziehen sich zusammen und die schlammbraunen Äuglein fixieren den jungen Farmer. Murmelnd fingert er an seiner goldseidenen Weste, die den drallen Bauch, spitz unter rostbraunem Hemdentuch gewölbt, nur mit Mühe umschließt. Mit bloßer Hand wischt er Schweiß aus seinem Nacken und er schreit, ohne den Blick vom Marktplatz abzuwenden, mit Weiberstimme: »Gregorius! Gregoriuuus!«
Die Schlinge zieht sich zu
Leider ist Abe nicht der einzige, der dem ahnungslosen Gavri’el misstraut. Auch der Stadtarzt, Hyram Hutton, und – viel wichtiger – die Drei Ältesten, namentlich Daveth, Myghal, Jowan oder: Die Bewahrer sorgen sich. Kurz gefasst: Morcant, Hyrams Sohn und Gavri’els bester Freund aus Kindertagen, wird aufs Übelste instrumentalisiert und Gavri’el landet im Kerker. Aber ausgerechnet dieses Verlies eröffnet ihm die Chance, Hokolesquas sorgsam verborgene Mysterien zu ergründen. Damit nicht genug:
Hyram brodelt. »Wir können ihn doch nicht im Kerker verrotten lassen.«
»Selbst dort wäre er noch zu gefährlich.« Jowans Stimme bebt. »Er ist beliebt, die Leute würden nach ihm fragen.« Gelenkig erhebt er sich. »Ich sehe nur eine einzige Möglichkeit.« Sekundenschwere Pause. »Wir müssen ihn töten.«Ein imaginärer Fels schmettert auf Gavri’el und Nebel trübt seinen Blick.
»Unmenschlich«, ruft Hyram. »Er ist kein Verbrecher.«
»Mäßigen Sie sich«, mahnt Myghal, »mir gefällt dieser Gedanke ebenso wenig. Um bei Ihrem Gleichnis zu bleiben, würde ich meinen künftigen Mörder umbringen oder versuchen, eine andere, menschlichere Lösung zu finden, die mich vor ihm schützt?«
Doch Jowan sägt unbeirrt weiter. »Bedenken Sie einen unschätzbaren Vorteil. Die Tinktur hält Gavri’el nicht auf, doch haben wir nicht die geringste Ahnung, warum.«
»Ich könnte ihn näher untersuchen«, bietet Hyram näselnd an.
»Der richtige Weg«, Jowans Worte schneiden wie Langschwerter. »Doch keine Aufgabe für Sie. Ich dachte«, er lässt die Silben auf seiner Zunge flüssig werden, »an den Operateur der Kolonie Catori, Ezra Keezar, der Beste seiner Zunft. Er könnte Gavri’els Gehirn sezieren, vielleicht stößt er auf Anomalien.«
Ausbruch ins Unbekannte
Nun kommt endlich der alte Feigenbaum ins Spiel, der Gavri’el zur Flucht verhilft. An Morcants Seite begibt sich Gavri’el auf die Suche nach der Wahrheit. Er will Gewissheit über all das Ungeheuerliche, was er in Hokolesquas Kerker erfahren hat. Aber auch das Dunkel seiner Herkunft durchdringen und endlich das peinigende Gefühl, anders als andere Menschen zu sein, verstehen. Ihre Suche führt die Freunde auf ihren Pferden Chanokh und Aharon durch ein weites Land und das ist selbstredend spannend und gefährlich, andernfalls bräuchte Gavri’els Geschichte nicht erzählt zu werden ☺.
»Wir sind Freunde. Schluss«, beendet Morcant das Thema.
»Die besten«, bekräftigt Gavri’el.
Stationen einer Flucht
Mit Gavri‘el ergründen wir ein wahrhaft gruseliges Spital und treffen dort Menschen anderer Kolonien – die es gar nicht geben dürfte. Zumeist Entrechtete wie Trevor, Liberty, Naoki, um die wichtigsten zu nennen, und natürlich das alte Moorweib. Und Shulammite, Botin der unglaublichen Lebenslüge über Gavri’els Herkunft. Während seiner Flucht zittern wir immer wieder mit Gavri’el, ob er seine Aglaya jemals wiedersehen wird. An seiner Seite brechen wir zum heilsverkündenden Osten auf, suchen dort einen sagenumwobenen Schlüssel, ohne zu wissen, ob er existiert. Wir kämpfen in einer Zeltstadt ums Überleben, erfahren die Bedeutung von Hecitu Yelo, übernachten auf der Frischlingslichtung und essen dort Hirschgulaschsuppe. Wir hören vom Club Clé Privée, lernen den Ursprung allen gutgemeinten Übels, die Kannensische Katstrophe sowie das Gelübde von Louisville kennen und schließlich auch den vielleicht doch nicht so verrückten Pierre, dessen Lieblingsgetränk Engelsmusik ist.
Zwischen schmierigen Töpfen, Tellern und Krügen zieht Pierre ein dreckiges Tuch hervor, schnäuzt graziös, faltet seine Hände wie zum Gebet und rezitiert zur längst von Spinnweben besiegten Decke: »Die Toten werden euch den Weg weisen. Das waren Leolas Worte, ihr Erbe, damit wir uns nach fünfhundert Jahren zurechtfinden.«
Ende gut … ?
Am Ende erleben wir, wie uralte Geheimnisse einer untergegangenen menschlichen Zivilisation im wahrsten Sinne des Wortes gehoben werden und werden Zeuge einer Tragödie, die dennoch hoffen lässt.
Synchron senken die Kolkraben ihre Köpfe, schütteln ihre Federn und schwingen sich in einen lichten, endlosen Tag.

Danielle Weidig
Autorin
Danielle lebt nahe Frankfurt/ Main, schreibt Phantastik, Fantasy und düstere Zukunftsromane (Dystopien), oft mit fantastischen Elementen (z. B. aus Dark Fantasy/ Urban Fantasy). Zudem belletristische Erzählungen, Kurzgeschichten und Gedichte in Anthologien und Literaturzeitschriften.